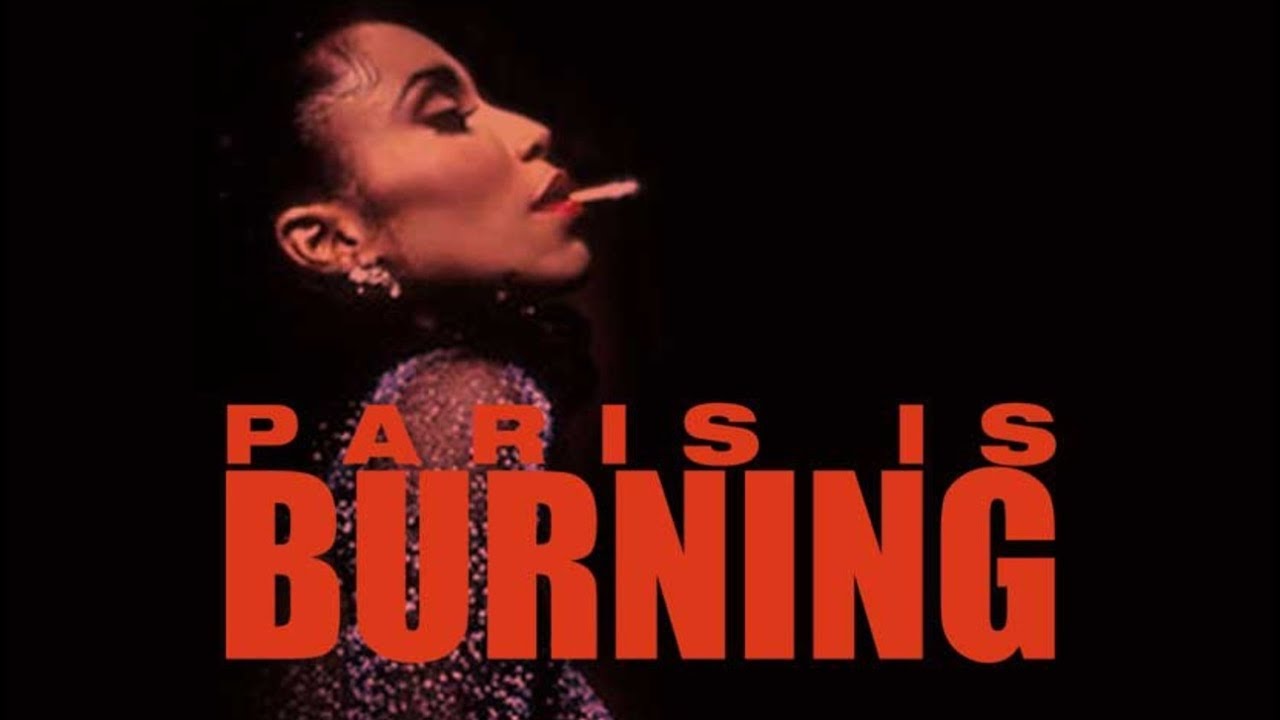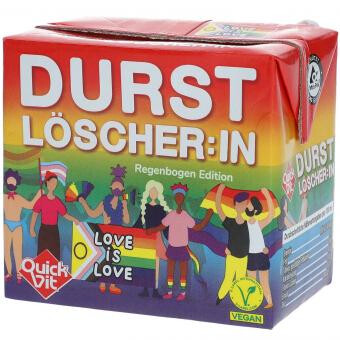Viele der Diskussionsstränge scheinen hier zu enden mit „ich geb’s auf, die andere Seite will mich nicht verstehen.“ Vielleicht mal ein Versuch sich das anzuschauen - ohne zu werten welche Seite jetzt „richtiger“ ist (wenn es das in dem Zusammenhang überhaupt gibt).
Es wurden hier schon mehrere Gründe auch direkt und indirekt angesprochen, was für die Disconnects in dieser Diskussionen sorgen. Ich will mich hier bewusst einschränken, um es greifbarer zu machen. Es gibt, wie gesagt, auch etliche andere Gründe, wie selektive Wahrnehmung, confirmation bias, ad hominem Argumente und all diese schönen Buzzword Begriffe, die alle zurecht ihre Bedeutung haben, die man alle hier in der Diskussion zu Hauf beobachten kann, wie sie zum tragen kommen und auch teil des disconnects in der Diskussion erklären. Aber ich will es auch nicht zu lang werden lassen und nur ein oder zwei rausgreifen: whataboutism, der damit auch verbunden der Versuch alles mit allem zu vergleichen und der entstehende Tribalismus.
Zum Whataboutism gibt nicht nur unzählige Beispiele in anderen Kontexten, aber allein hier in diesem Thread finden sich dutzende Beispiele (auf „beiden Seiten“ ). Das führt dann hier und vielerorts dazu, dass wir plötzlich auf völlig unterschiedlichen Ebenen diskutieren, ohne es zum Teil zu merken (einseitig, häufig aber auch beidseitig).
Um es konkreter zu machen: Eines der Argumente der Gender"gegner" ist die (whatabout) Ästhetik („stört den Lesefluss“, „ich kann einen Podcast mit gendergerechter Sprache nicht mehr hören“). Während viele der „Befürworter“ ins (whatabout) politische gehen und betonen wie wichtig die Sprache für Gleichberechtigung, Awareness, usw. ist. Zum Thema Ästhetik gibt es von der Seite den (whatabout) Konter „Sprache entwickelt sich und man gewöhnt sich dran“. Andersrum gibt es zum Thema Politik als (whatabout) Konter „Gendergerechte Sprache kann ja politisch gar nicht soooo Einflussreich sein“. (und dann auch nicht selten wieder mit Ästhetik begründet). Also, das ist wirklich stark verkürzt, und es gibt alleine hier auch etliche Nuancen davon und es gibt neben diesen beiden Aspekten auch andere Felder, die hier schon benannt und beackert wurden, ist mir klar. Ich will jetzt aber auch nicht alles nochmal wiederholen, sondern einfach nur ein konkretes Beispiel rausgreifen. Das ließe sich aber auch auf die anderen Felder übertragen.
Bzgl. dieses Beispiels: Ästhetik und politische Bedeutung sind einfach zwei völlig unterschiedliche Aspekte des Themas. Kann man beides für sich ohne Probleme diskutieren, aber um der Diskussion gerecht zu werden, kann, ja wahrscheinlich muss man das einfach voneinander trennen. Die Grenzen vermischen sich leider immer in solchen Diskussionen. Dabei kann man beides erstmal befürworten oder ablehnen. Aber es scheint darüber hinaus wohl einen unausgesprochenen Konsens zu geben, dass „Wer Gendern gut findet, will mir die (seine/ihre) Ästhetik aufzwingen“ und andererseits „Wer Gendern nicht gut findet, ist automatisch gegen Gleichberechtigung“. So, dass sich Lager (oder Tribes) bilden und während die eine Seite über Gleichberechtigung argumentiert, versucht die andere Seite zu kontern, dass ja dieser Gender-* im Schriftbild einfach nicht gehe (wieder überspitzt, und es gibt Mischformen und funktioniert in die andere Richtung genauso).
Schlussendlich haben wir hier den Tribalismus, der zum einen in dieser Diskussion ganz verworrenen Grenzen hat, zum anderen das definierende „ich/wir gegen die“ Gefühl hervorruft (wieder beidseitig). Und das kann nicht voran gehen, weil plötzlich alles mit allem verglichen wird. Dinge, die überhaupt nicht vergleichbar sind: man kann sehr wohl den Gender-* total daneben finden und trotzdem total für Gleichberechtigung sein. Auch dieser Aspekt wurde im Laufe der Diskussion auch so schon benannt, hat aber nicht wirklich dazu geholfen, dass man sich irgendwo trifft. Dafür ist man zu sehr in seinem eigenem Tribe verwurzelt.
Um mal in den Spielekontext umzuleiten: es gab sehr viele Meinungen zu „Return of Monkey Island“, dass der Grafikstil ja so überhaupt nicht gefällt. Und dann häufig auch Wortbeiträge zu hören/lesen waren in die Richtung: „Das restliche Spiel kann ja noch so toll, sein, mir gefällt dieser Stil nicht und ich kann das daher nicht spielen“. Während die andere Seite zurückgab: „Wie kannst du nur das geniale Rätseldesign, etc nicht mögen?“ Auf dieser Ebene konnte es keinen Konsens geben und diese Parallele erinnert mich frappierend an einige der Diskussionsstränge hier. (wieder zurechtgerückt: I know, it’s complicated, und es gibt hier auch Diskussionsstränge, die anders verlaufen (sind))
Die spannende Frage ist nun, wie man das Auflösen kann. So richtiges Patentrezept gibt es wohl nicht, sonst hätte man den in der öffentlichen Diskussionskultur schon angewandt. Auch scheinen mir dafür die Gräben bei manchen Themen, so wie diesen hier einfach zu groß zu sein, als dass man sie überwinden kann (siehe Tribalismus). Aber, wie bei so vielen Sachen, hilft vielleicht als erstes eine Reflexion dessen, was ist. Das hilft nicht jeden und auch nicht bei allen. Aber, meine Erfahrung (persönlich, wie angelesen): bevor man überhaupt an die Problemlösung geht, sollte man sich selbst reflektieren, was passiert hier eigentlich, warum versteht mich die andere nicht und warum kommen wir nicht voran? Und natürlich haben das einige hier schon gemacht und auch Kund getan. Und es scheint in vielen Strängen trotzdem nicht weiterzugehen bis man entnervt aufgibt. Das bestätigt entweder meine Befürchtung oder man muss noch tiefer graben. In der mgmt Theorie gibt es da diesen schönen Begriff der „Five Y“ (oder „Five Why“): Um an den Kern eines Problems zu kommen, muss man mindestens fünf mal „why“ fragen. Vielleicht kann man das hier auch irgendwie anwenden (in dem Fall auf sich selbst hinterfragen)?